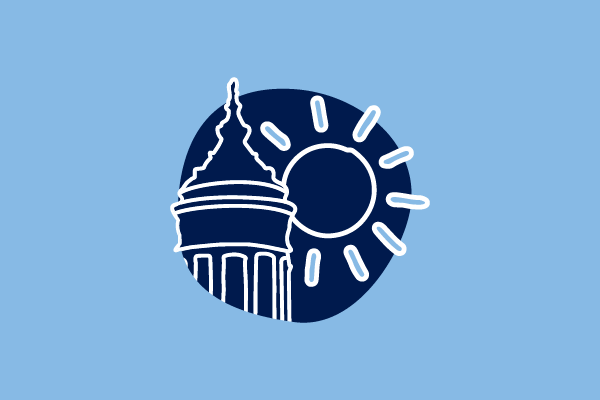Mannheim. Die Liste seiner Regiearbeiten ist beeindruckend. Seit gut 15 Jahren setzt sich der russische Theatermacher und Aktivist Maxim Didenko hauptsächlich mit russischer Geschichte, Kultur und Gegenwart auseinander. Als Regisseur galt er in den 2010er Jahren von Sankt Petersburg bis Nowosibirsk als Vertreter einer neuen Generation, der mit bildgewaltigen Inszenierungen in multimedialer Ästhetik immer gut für eine Theatersensation war. Auch Bühnen in Prag, Berlin, Dresden, Karlsruhe und London wurden auf ihn aufmerksam. In Mannheim ist seine Adaption des Heinrich-Böll-Romans „Ansichten eines Clowns“ von 2021 in guter Erinnerung.
Doch dann kam der 24. Februar 2022. Als vehementer Kritiker des russischen Angriffskriegs verließ Maxim Didenko Russland, um seine künstlerische und persönliche Freiheit zu bewahren. Seitdem lebt er dort, wo er gerade arbeitet. Im Moment also in Mannheim, wo am Nationaltheater mit seiner Inszenierung „Die Nacht von Lissabon“ nach dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque die Schauspielsaison im Alten Kino Franklin eröffnet wird.
Remarque war schon in der Sowjetunion äußerst populär
Bei unserem Gespräch im Theatercafé Franklin erzählt er, dass alle Exilrussen gerade Remarques 1962 erschienenen Roman lesen und diskutieren. Überhaupt sei der deutsche Schriftsteller schon in der Sowjetunion äußerst populär gewesen. Erstaunlich, dass hierzulande viele noch nicht einmal von ihm gehört hätten. Die Lektüre - erst auf Russisch, danach auf Englisch - habe sich ihm eingebrannt. Das Thema Exil treffe ja auch auf ihn zu. Deshalb schlug er den Stoff im Frühjahr 2022 Schauspiel-Intendant Christian Holtzhauer vor: „Ich habe sofort einen kreativen Zugang gefunden und wusste, wie ich es machen wollte.“
Worum geht es? Im Hafen von Lissabon begegnen sich 1942 zufällig zwei deutsche Männer. Der Exilant Schwarz verspricht dem anderen seine beiden Tickets und einen gefälschten Pass für die rettende Schiffspassage nach Amerika. Einzige Bedingung: in dieser Nacht bei ihm zu bleiben und seine Erinnerungen zu teilen. So erzählt Schwarz, während die beiden bis zum Morgengrauen von Kneipe zu Kneipe ziehen, nicht nur von seiner zermürbenden Flucht vor der SS und der großen Liebe zu seiner krebskranken Frau Helen. Er hinterfragt auch Gefühle, Gedanken und Haltung.
An Remarques Romanvorlage interessiert den Regisseur besonders der Versuch des Entkommens. „Das ist eine Dystopie. Man kann nicht weglaufen vor seiner Vergangenheit und auch nicht vor dem Tod.“ Der katastrophale Zusammenbruch der Welt durch den Krieg bringe aber noch eine weitere Sehnsucht mit sich: „Jetzt im Augenblick zu leben, zu lieben und mutig zu sein.“ In seiner aktuellen Lebenssituation habe er vergleichbare Erfahrungen. Ähnlich wie die Romanfiguren, in denen wohl ein Stück Erich Maria Remarque stecke, wisse auch Didenko nicht, was als Nächstes passiere. Alles sei ungewiss, er habe gelernt, auf schnelle, unerwartete Veränderungen vorbereitet zu sein.
Seit langem beschäftigt sich der russische Regisseur mit den harten Realitäten von Revolution, Repression, Bürgerkrieg, Faschismus, Totalitarismus, Flucht und Unterdrückung: „Wie wird eine Gesellschaft totalitär, wie kann der Staat Menschen kontrollieren und zerstören? Ich fühle mich berechtigt, den Preis der Freiheit zu erforschen.“
Helens Krebserkrankung zum Beispiel sei eine Metapher für den Faschismus, der sich damals wie heute in immer mehr Ländern ausbreite. „Die Welt wird immer kränker und gewalttätiger,“ stellt er mit gewisser Verzweiflung fest. „Und es gibt keine Antwort auf dieses Problem.“
Didenko: Man muss die Welt immer wieder in Frage stellen
Doch neuerdings verspüre er den Wunsch, sich aus seinem Trauma, das der russische Krieg gegen die Ukraine in ihm ausgelöst hat, zu befreien. „Ich möchte eine gewisse Leichtigkeit. Weil ich glaube, dass der Wunsch zu leben und zu lieben das Einzige ist, was uns retten kann.“
So erarbeitet er mit seinem international besetzten Kreativteam ein multimediales Projekt an der Schnittstelle von Theater, Film, Video, Musik und Tanz. Eine Art Musical in der schwarz-weißen Filmästhetik der 40er Jahre. In Rückblenden wird die Vergangenheit von Schwarz lebendig. Die Schauspieler schlüpfen in mehrere Rollen, die Drehbühne eröffnet unterschiedliche Räume.
Wenn Didenko über Remarque und den Zustand der Welt spricht, wirkt er nachdenklich, melancholisch, sucht nach den passenden englischen Worten: „Die Leichtigkeit und die Traurigkeit in Remarques Geschichte geben doch irgendwie Hoffnung. Die ist wichtig für mich.“ Allerdings müsse man die Welt immer wieder in Frage stellen. Fragen stellen sei wichtiger als Antworten zu bekommen, denn dann würde das Fragen ja aufhören. „Die Kunst kann fragen und sie kann den Menschen wenigstens Hoffnung geben. Die Welt verändern kann sie aber nicht.“
URL dieses Artikels:
https://www.fnweb.de/kultur_artikel,-kultur-das-sagt-regisseur-maxim-didenko-ueber-seine-neue-inszenierung-am-ntm-_arid,2245839.html